Vor einer Woche berichteten wir über eine Randveranstaltung der Quadriennale Düsseldorf, die „Toom-Ausstellung“, die einen gemischten Eindruck hinterlassen hatte. Erst heute kommen wir auf einen Höhepunkt des Festivals zurück, der zwar eine ganz andere Aufmerksamkeit als die üblichen Blockbuster-Shows der Quadriennale erhielt, jedoch kuratorisch makellos war. Man kann sogar ohne Übertreibung behaupten, dass das in der Altstadt verstreute Videoprogramm von Jan Wagner perfekt war.

Bilder: Katja Illner
Perfekt war das Programm nicht nur weil die einzelnen Bestandteile des Screenings Prädikate von sehenswert bis extrem wertvoll verdient haben, sondern weil die Auswahl der jeweiligen Projektionsorte eine verblüffende Stimmigkeit aufwies. Jan Wagner, selbst Künstler und im Vorstand der Filmwerkstatt Düsseldorf tätig, hat gezeigt, dass er eine hohe Sensibilität für den schwierigen Dialog zwischen Videokunst und ihrem Präsentationsraum besitzt. Die ca. 20 Positionen von Arena wurden nämlich nicht in abgeschirmten Black Boxes ausgestrahlt, sondern in diversen Kneipen, Bars und Tanzklubs der Altstadt, eingebunden in die jeweilige Atmosphäre der Lokale, integriert in diese postmoderne Architektur der Unterhaltung und der anspruchslosen Zerstreuung – und zwar an einem Samstag, also am Klimax des Saufbetriebes.




Die Herausforderung lag in der Integration eines sehr heterogenen Videomaterials in das trubelige Biotop der Altstadt und in der Schöpfung von sinnvollen Korrespondenzen, bzw. Dissonanzen. Gemeistert. Um nur wenige zu nennen: Die Loops von Giulia Bowinkel und Friedemann Banz, bestehend aus virtuellen, glatt designten Gegenständen von ungeklärter Natur, wurden in der unterkühlten und aseptischen „Hausbar“ gezeigt; Alexander Wissel und Nicolai Szymanski hatten ein Karaoke in der trashigen „Kulisse“ (eine Art Ballermann-Bar für enthemmte Mittelschicht-Party-Löwen im besten Alter) installiert und die melancholischen und rätselhaften Landschaften von Luke Fowler, irgendwo an der englischen Küste gedreht, wurden in „Fatty’s Irish Pub“ projiziert. Abwechslungsreich also, und irgendwie immer passend.
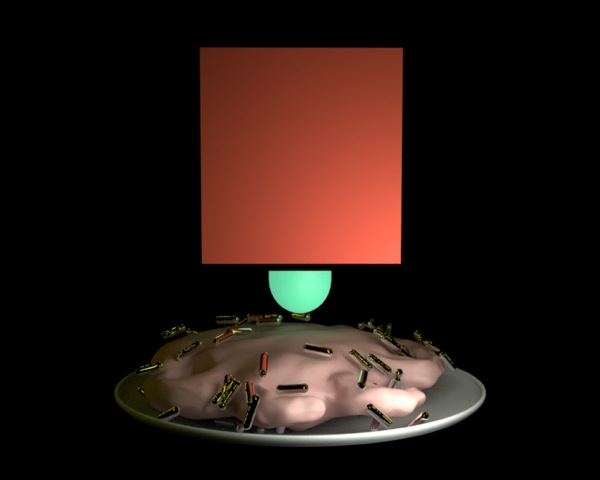


Indem er auf krasse Gegensätze oder, häufiger, auf filigrane und subtile Äquivalenzen setzte, gelang es Jan Wagner sowohl auf dem genius loci jeder einzelnen Station als auch auf bestimmte Aspekte des jeweiligen Films aufmerksam zu machen. Bar jedes didaktischen Impetus wurden formale oder thematische Verbindungen zwischen Kunst und Raum unterstrichen; unverkrampft wurde der Blick des Betrachters auf Details seines Aufenthaltsortes gelenkt und ließ fruchtbare Assoziationen zwischen Bild und sozialer Umgebung entstehen.



Obwohl ich mittlerweile skeptisch gegenüber jeglicher Invasion von Kunst in fremden Milieus bin (weil das Folkloristische meistens die Überhand über die Kunst selbst nimmt und die Aktion in ein putziges Event verwandelt), muss ich gestehen, dass der provozierte Kultur-Clash spannend und anregend war. Es war eine wahre Wonne, auf Kunst-Safari durch die Party-Gassen zu schlendern, sich einen Weg durch die grölenden Massen und schwer angetrunkenen Junggesellenabschiedsgruppen zu bahnen und sich immer wieder auf das neue Setting einzulassen. Ein sinnliches und intellektuelles Vergnügen, das die eben erwähnte Event-Gefahr problemlos umging.








